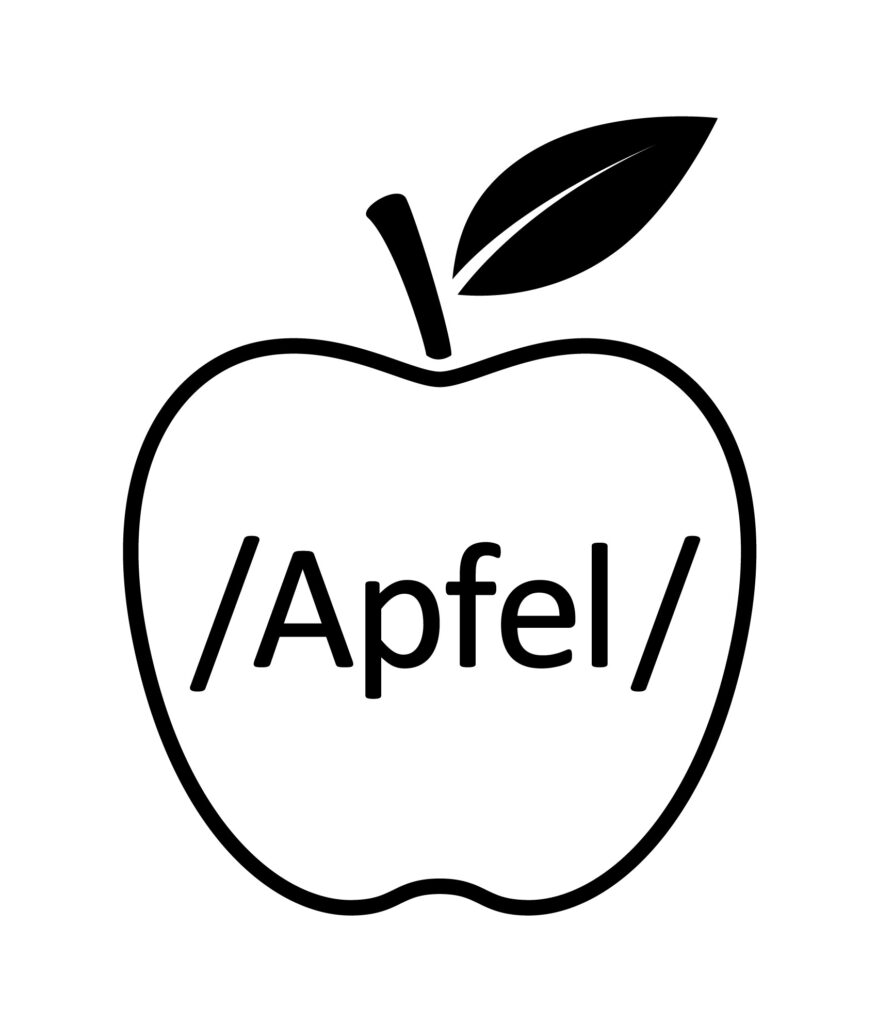
1. Kategoriale binäre Unterscheidungen, also Dualismen, präg(t)en vor allem unser philosophisches Denken: Götter und Menschen, Himmel und Erde, Jenseits und Diesseits, Leben nach dem Tod und Leben vor dem Tod, Seele und Leib, Geist und Materie, res cogitans und res extensa, Denken und Sein, Subjekt und Objekt, Kultur und Natur, Interpretationen und Fakten, Meinungen und Tatsachen, Werturteile und Tatsachenbehauptungen, Falschheit und Wahrheit, Überbau und Basis, These und Antithese, und in der Politik und in den Medien – sich derzeit (im Jahr 2025) zunehmend polarisierend – Links und Rechts.
2. Man könnte mit Naturerscheinungen argumentieren, die dualistisches Denken plausibilisieren: Mann und Frau, Tag und Nacht. Der Dualismus könnte also naturalistisch begründet werden. Aber andere Naturerscheinungen plausibilisieren eher zyklisches Denken, etwa der Lauf der Jahreszeiten oder die Bewegungen der Planeten. Und die soeben verwendete Unterscheidung zwischen Naturerscheinungen und unserem Denken ist nichts anderes als ein Dualismus.
3. Viele Dualismen des Denkens wurden im Laufe der Philosophiegeschichte problematisiert, wenn nicht dekonstruiert: So sind etwa die Dualismen von Göttern und Menschen, Himmel und Erde oder Jenseits und Diesseits aus der Philosophie verschwunden, auch von einer „Seele“ wird im wissenschaftlichen Zusammenhang nicht mehr gesprochen.
4. In großen Denksystemen der neuzeitlichen Philosophie wurde mitunter der Versuch unternommen, Dualismen in einer Synthese aufzuheben (in der Dialektik Hegels) oder etwa einen alten Dualismus durch einen neuen, flexibleren zu ersetzen, wie etwa die Unterscheidung von System/Umwelt (in der Systemtheorie Luhmanns). Manche Dualismen benötigen ein drittes Glied, ein Medium der Unterscheidung – wie die Welt bei Luhmann. Popper hat explizit eine Drei-Welten-Theorie vertreten (Materie, Geist und Kultur). Es wurden auch neue Glieder von Dualismen eingeführt, wie etwa das „Ding an sich“ durch Kant.
5. Gehalten hat sich jedoch in allen philosophischen Theoriegebäuden seit ca. 2.500 Jahren die Voraussetzung einer Unterscheidung von Namen und Dingen (Platon), Begriff und Anschauung (Kant), Begriff und Gegenstand (Frege), Zeichen und Bezeichnetem (de Saussure), Sprache und Wirklichkeit (Wittgenstein) oder Wort und Objekt (Quine, Foucault) als conditio sine qua non des Denkens (nach Josef Mitterer). Es gibt angeblich die Sprache und die von der Sprache kategorial zu unterscheidende, also nicht-sprachliche Wirklichkeit, wobei die Sprache der Wirklichkeit „gegenüber stehen“ oder aber die Sprache auch als Teil der Wirklichkeit verstanden werden kann. Am häufigsten wird Sprache aber als irgendetwas Ideelles gedacht, das der materiellen Wirklichkeit in irgendeiner Form analytisch bzw. kategorial gegenübersteht.
6. Ich sage nicht, dass dieser sprachphilosophische Dualismus falsch wäre. Ich werde im Folgenden aber mit Josef Mitterer argumentieren, dass er optional ist, also nicht notwendig, weil bislang niemand daran gedacht hat, dass es auch eine andere Redeweise – und mit ihr eine andere Notation – geben könnte.
7. Schon in Platons „Kratylos“, in dem die Unterscheidung von Namen und Dingen stillschweigend eingeführt und im Fortgang des Dialogs vorausgesetzt wird, sind sich die Gesprächspartner der Schwierigkeiten durchaus bewusst, die das Folgeproblem dieser nicht-problematisierten Unterscheidung, nämlich die Debatte von Naturalismus versus Konventionalismus, mit sich bringt: Wenn uns Namen (bei Platon: ὀνόματα, onomata) etwas über die „Natur“ oder das „Wesen“ der Dinge (bei Platon: πράγματα, prágmata oder ὄντα, onta) erzählen, haben dann nicht auch Handlungen – wie etwa auch Sprachhandlungen – eine Natur, ein Wesen? Aber wenn es nun eine natürliche Richtigkeit der Namen gäbe, wie weit lässt sich diese zurückführen und wie sehr in die kleinsten Wortbestandteile, nur zu einer Silbe oder zu einem Buchstaben, hinein? Die Antwort von Sokrates ist hier ausweichend: Die etymologische Rückschau führe vielleicht zurück in sehr alte und nicht mehr zugängliche Sprachen, in ausländische Sprachen oder zu Gott als initialem „Namensgeber“ der „Stammwörter“: Wir treffen auf einen frühen Regressunterbrecher durch ein Dogma, wie es im 20. Jahrhundert Hans Albert formuliert hätte.
8. Die Unterscheidung von Namen und Dingen taucht zur „Achsenzeit“ der Menschheitsgeschichte (Jaspers), also ca. im 5. bis 4. Jhdt. v. Chr., auch in der indischen und chinesischen Philosophie auf: und zwar in Indien bei Yāska (im „Nirukta“) und in China bei Mozi (im „Mohistischen Kanon“) – in China übrigens stärker expliziert als in Indien, Indien ist also schon damals etwas „non-dualistischer“ gewesen.
9. Der neue Vorschlag von Josef Mitterer (ersonnen 1973-1978, erstmals publiziert 1992, wieder publiziert 2011) lautet (für das Verständnis entscheidende Ergänzungen durch mich von Josef Mitterers Wortlaut in fett): Das Objekt der Beschreibung ist jener Teil der Beschreibung, der vor ihr bereits ausgeführt worden und die konsensuelle Basis für die restliche Beschreibung ist.
Anders formuliert: Das Objekt der Beschreibung ist jener Teil der Beschreibung, der zu einem früheren Zeitpunkt bereits ausgeführt worden und die konsensuelle Basis für die restliche Beschreibung ist.
Und noch einmal anders formuliert: Das Objekt der Beschreibung ist jener Teil der Beschreibung, der bereits ausgeführt worden ist, bevor die Beschreibung vollendet wurde und der die konsensuelle Basis für die restliche Beschreibung ist.
Das Beispiel:
Der Apfel liegt auf dem Tisch, ist angebissen und faul.
Das Objekt dieser Beschreibung kann nun sein, je nach Stand des Konsenses: Der Apfel oder der Apfel, der auf dem Tisch liegt oder der Apfel, der auf dem Tisch liegt und angebissen ist oder der Apfel, der auf dem Tisch liegt und angebissen und faul ist.
10. Hier wieder Mitterers Wortlaut mit meinen Ergänzungen in fett: Das Objekt der Beschreibung verhält sich zur Beschreibung des Objekts wie die bereits früher ausgeführte, bereits konsensuelle Beschreibung until just now zur danach (statt: „noch nicht“ bei Mitterer) ausgeführten, noch nicht konsensuellen (fraglichen) Beschreibung (oder zur Beschreibung, über die wir reden wollen) from before on.
11. Objekte und das, was wir Objektsprache nennen, fallen zusammen. Die neue Notation dafür lautet: /…/ (Mitterer schlug vor, die Notation /…/ Ausführungszeichen zu nennen). Wenn wir über den Apfel reden (im herkömmlichen Denken), reden wir über /den Apfel/ hinaus (im neuen Denken), wir reden mehr als bloß /der Apfel/. Es ist ein anderes Reden, ohne Reden-über und ohne Bezug (Referenz) auf die Dinge.
12. Ich kann selbstverständlich weiterhin zwischen dem Apfel und „dem Apfel“ unterscheiden. Um das zu tun, muss ich ja /dem Apfel/ im Satz soeben vor (oder wahlweise auch nach) „dem Apfel“ gesagt haben.
13. Alle etymologischen Erörterungen, wie sie die Gesprächspartner im „Kratylos“ angestellt haben, sind weiter möglich: Der Apfel liegt auf dem Tisch, aber „der Apfel“ liegt nicht auf dem Tisch. „Der Apfel“ besteht aus zwei Wörtern, aber der Apfel besteht nicht aus zwei Wörtern. In beiden Sätzen soeben wurde nicht nur jeweils „der Apfel“ in doppelte Anführungszeichen gesetzt, es wurde ja auch beide Male /der Apfel/ gesagt.
14. Die vielen unbenannten Phänomene sind die mit „viele unbenannte Phänomene“ benannten Phänomene. Etwas als unbenannt (hier soeben: etwas) zu benennen, ergibt somit keinen Sinn. Die Welt und das Benannte fallen zusammen, hier eben /die Welt/ und /das Benannte/. „Ohne Worte“ ist mit Worten. Wer „Ich finde keine Worte.“ sagt, hat Worte gefunden.
15. Die neue Notation /…/ meint, dass der Apfel, der auf dem Tisch liegt, und /der Apfel, der auf dem Tisch liegt/ dasselbe sind.
16. Wenn ich den grünen Apfel einen blauen Apfel nenne, wird er dann blau? – Nein, denn ich bin in diesem Beispiel mein eigener Advocatus Diaboli: Ich weiß, dass es anders ist, als ich es sage. Ich habe ja bereits gesagt, dass der Apfel grün ist. /Der grüne Apfel/ liegt bereits vor.
17. Die Unterscheidung zwischen Ding und Wort kommt immer erst nach dem Wort. Die Zeit läuft während dieser Unterscheidung weiter. Damit ist das Ding aber nicht mehr kategorial vom Wort verschieden.
Die Mainstream-Philosophen würden sagen: Das ist der klassische Fehler des Idealismus. Es werden Anschauungen von Dingen mit Dingen von Anschauungen verwechselt (nach Franz von Kutschera).
18. Ein weiterer Einwand: Die Nicht-objektierende Redeweise argumentiere wie der Solipsismus: Aus der Tatsache, dass es die Unterscheidung zwischen dem eigenen Bewusstsein und der Außenwelt nur im eigenen Bewusstsein gibt, folge nicht, dass es die Außenwelt nur im eigenen Bewusstsein und es sohin überhaupt nur dieses gebe. – Aber die Nicht-objektierende Redeweise sagt ja nicht, dass es nur Sprache, nur Beschreibungen oder nur Wörter gebe.
19. Das Universum ist viel älter als die menschliche Sprache. „Das Universum ist viel älter als die menschliche Sprache.“ ist eine Beschreibung, die den bereits ausgeführten Teil /das Universum/ fortsetzt (siehe auch Mitterer 2011, S. 75 f.). Die Unterscheidung zwischen dem Satzinhalt und dem Satz ist erst nach dem Satz möglich und geht bei der Angabe des Satzinhalts mit einem neuen, weiteren Satz einher.
20. Die Nicht-objektierende Denkweise sagt nicht, dass es kein Objekt gibt, das nicht Sprache ist (siehe auch Mitterer 2011, S. 45). Sie sagt vielmehr, dass die Vorstellung von von der Sprache kategorial verschiedenen Objekten nicht zwingend ist.
21. Gibt es im Nicht-objektierenden Denken dann nicht zwei Notationen (/…/ und „…“) und damit zwei Sprachen oder zumindest zwei Sprachebenen? Ja, aber auch im bisherigen Objektierenden Denken gibt es diese, denn in diesem wird zwischen Objektsprache und Metasprache unterschieden. Der Unterschied liegt in der Nicht-Unterscheidung von Objekten und Objektsprache.
22. Das Tarski-Schema (Der Satz „Der Schnee ist weiß.“ ist dann und nur dann wahr, wenn der Schnee weiß ist.) wird zur Redundanz. Eine Aussage wird wiederholt. Das Tarski-Schema ist eine Tautologie. Die Verleihung des Wahrheitsprädikats wird erst möglich durch den Einsatz doppelter Anführungszeichen.
23. Die Vorstellungen von Wahrheit und Falschheit im Sinne einer Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung einer Aussage mit einem Sachverhalt werden überflüssig. Wahrheit meint in der Nicht-objektierenden Redeweise lediglich die Zustimmung zu einer Aussage, Falschheit lediglich die Ablösung der Aussage durch eine neue Aussage (nach Mitterer).
24. Die Vorstellung eines Bezugs, einer Referenz eines Worts auf ein Ding wird überflüssig: Durch die Angabe /Ding/ ist ja bereits die Einheit hergestellt worden.
25. Verlieren wir damit die Welt im Sinne einer dramatischen Zuspitzung von Rortys „The Word Well Lost“? – Nein. Die Welt ist nur nicht alles, was der Fall ist, wie dies noch der frühe Wittgenstein vorgeschlagen hatte. Die Welt ist mit Mitterer das, was gesagt wurde.
26. Damit ergeben sich fundamentale Konsequenzen für Fragen nach dem „Anfang“ des Universums und der Rekonstruktion der Vergangenheit(en). Die Vergangenheit vor der Sprache – kosmologisch, phylogenetisch wie ontogenetisch – wird erst im Verlauf der Beschreibungen ‚sichtbar‘ (ähnlich Mitterer 2011, S. 86).
27. Der Entwurf einer Nicht-objektierenden Redeweise mit ihrer neuen Notation wurde von Mitterer 1978 in seiner Doktorarbeit publiziert. Diese wurde erst 1992 in Buchform veröffentlicht. „Hätte Mitterer seine Dissertation nie veröffentlicht, wäre die Nicht-objektierende Redeweise nie bekannt geworden.“ Dieser Satz ergibt in der Nicht-objektierenden Redeweise keinen Sinn, weil er ja die Bekanntheit der Nicht-objektierenden Redeweise voraussetzt.
28. Ähnlich verhält es sich mit Fragen der Art: „Würde es das Universum auch dann geben, wenn sich die menschliche Sprache – oder eine ähnliche (außer)irdische Ausdrucksform – nie entwickelt hätte?“ – Die Bedingung der Möglichkeit der Frage ist ja die Sprache.
29. Der Einwand der (Neuen) Realisten lautet: Das betrifft aber nur die Frage, nicht den Sachverhalt. Die Nicht-objektierende Redeweise entgegnet, dass auch die Unterscheidung zwischen Frage und Sachverhalt erst nach der Frage möglich ist.
30. Die Nicht-objektierende Redeweise ist die säkularisierte Variante von Im Anfang war das Wort, wobei sie präzisiert: Im Anfang war „im“.
Terminologische Bemerkung
Alternative Bezeichnungen für dieses neue Denken (soeben ausgeführt: /dieses neue Denken/) sind „Nicht-objektierende Redeweise“ (Mitterer 1978 und Weber hier), „Nicht-dualisierende Redeweise“ (Mitterer 1992/2011) und „Radikaler Lingualismus“ (Weber 2022 ff., basierend auf der öffentlichen Ersterwähnung dieses Begriffs in Mitterers „Die Flucht aus der Beliebigkeit“ 2011, diese basierend auf der Erwähnung im Gutachten zur Dissertation Mitterers von Rudolf Haller 1978).
Literatur
Mitterer, Josef (2011): Das Jenseits der Philosophie. Wider das dualistische Erkenntnisprinzip. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. Auszug hier
Weber, Stefan (2025a): Sprache, Mensch, Universum. Radikaler Lingualismus 2. Weilerswist: Velbrück Wissenschaft. Auszug hier
Weber, Stefan (2025b): Die unhinterfragte Denkvoraussetzung Name vs. Ding in Platons „Kratylos“. Weilerswist: Velbrück Magazin, https://velbrueck-magazin.de/2025/09/29/die-unhinterfragte-denkvoraussetzung-von-namen-und-dingen-in-platons-kratylos
Erste verbesserte Fassung vom 13.11.2025
Ich würde gerne Ihre Meinung zum Fall Hatice A. hören (Sozi-Doktorandin verklagt ihren Ghostwriter), der jetzt in Lüneburg verhandelt wurde (Urteil steht aus). Danisch bringt den Fall auch.
Ich habe mich mit dem Fall nicht beschäftigt, sorry! Ich kann nur allgemein antworten: In Österreich ist Ghostwriting immerhin seit 2021 ein Verwaltungsstraftatbestand, und auch die Beauftragung eines Ghostwriters (Bestimmungstäter). Der Fall zeigt also für mich, dass Deutschland bzw. seine Länder bewusst nichts juristisch gegen akademischen Missbrauch unternehmen. Erst so wurde doch die Klage möglich, ohne sich selbst mit einem weiteren Verfahren zu belasten. In welchem Bundesland spielt denn der Fall? Dann wäre ein Blick in das Länder-Hochschulgesetz mal für mich der erste Schritt. Gerne können Sie mich mit Infos füttern.
Ah ok, Niedersächsisches Hochschulgesetz: https://voris.wolterskluwer-online.de/browse/document/38127fea-24f4-37eb-b12f-1945254312bf
Ich habe auf die Schnelle keine Bestimmung zu Ghostwriting oder sonstigen GWP-Verstößen gefunden.
Vielleicht ist hier anzumerken, dass – die ‚dualisierende‘ Entwicklungspsychologie bemühend – der Spracherwerb ein irreversibler Akt ist, der nur im Fall eines Sprachverlustes (Demenz z.B.) rückgängig gemacht werden kann.
Solange wir Sprache kennen, ist jede Sinneswahrnehmung mit dieser ‚unternäht‘: ‚Ich bin hier und die schöne Landschaft breitet sich vor mir aus‘, ist als ‚Sprachwelt‘ im Hintergrund auch dann aktiv, wenn ich diese Szenerie als, ’so schön, dass es mir die Sprache verschlagen hat‘, erinnere. Oder das ‚Oben und Unten‘ ist uns implizit immer (ausser bei extremem Schwindel) klar, auch wenn wir es nicht innerlich oder äusserlich verbalisieren müssen.
Das heisst, Sprache ist auch dann ‚aktiv‘, wenn wir als sprachfähige Wesen Sinneserfahrungen machen und kein Wort explizit gedacht, gehört, geschrieben, gelesen oder gesprochen wird.
Wissenschaftlich Phänomene beschreiben zu wollen, die scheinbar ausserhalb der Sprache liegen müssen (Tiere, Babies, Anfänge oder Enden der Evolution/des Universums, Teilchenphysik etc.) stösst diese in die Sprache rein und können somit nicht als unabhängig vom Besprechenden postuliert werden. D.h. ‚das Ethos‘ des ‚Möglichst-objektiv-Bleibens‘ der Naturwissenschaft stellt sich als prinzipielle Unmöglichkeit heraus – wegen der Sprache: Das angeblich sprachverschiedene ‚Objekt‘ kann niemals erforscht werden. Auch wenn wir eine möglichst sinnliche Wissenschaft erfinden würden, die ’sinnliche Erkenntnis‘ verspricht (um einem überwertigen Rationalismus zu entgehen), bedürfte diese der differenzierenden Macht der Sprache, die die fünf Sinne, Gefühle und Empfindungen scheiden kann. Durch das Bezeichnen entsteht ausdifferenzierte Welt, und ohne Unterscheidungen lässt sich keine Wissenschaft betreiben. In diesem Sinne lässt sich ‚Im Anfang war das Wort‘ quasi säkularisiert lesen.
Da gab’s schon vor längerer Zeit einen, der hat es auch gecheckt 😉:
Lieber Herr Dr. Weber,
wenn ich Ihren Text über das nicht-objektierende Denken richtig verstanden habe – und das ist bei Mitterer ja, wie man hört, kein ganz gefahrloses Unterfangen –, dann geht es im Kern darum, dass wir die Wirklichkeit nicht einfach vorfinden, sondern sie uns mit jedem Satz, den wir darüber sagen, selbst zusammensprechen.
Anders gesagt: Der Apfel ist nicht an sich grün, sondern wird es erst in dem Moment, in dem ich ihn grün nenne – und bleibt es, solange niemand auf die Idee kommt, ihn umzubenennen.
Beim Lesen musste ich unweigerlich an Friedrich Schulz von Thun denken, an seine „Landkarten der Wirklichkeit“. Nur scheint mir, dass Mitterer die Karte gleich mit dem Gelände verschmelzen lässt – was natürlich konsequent ist, wenn man das Gelände ohnehin nur durch Sprechen betritt.
Ich komme ja eher aus der technischen Ecke – Ingenieurwesen, Maschinen, Explosionsschutz – und bin daher mit objektivierbaren Größen wie Druck, Temperatur und Zündenergie vertrauter als mit philosophischen Notationen. Vielleicht gerade deshalb fasziniert mich dieser gedankliche Perspektivwechsel so, auch wenn das für mich als Techniker wirklich keine leichte Kost ist.
In diesem Zusammenhang stellt sich mir noch die Frage, wie sich dieses Denken zur Mathematik verhält. Die Mathematik ist ja letztlich eine Geisteswissenschaft, die ihre eigenen Gegenstände – Zahlen, Funktionen, Räume – in sich selbst erschafft und keiner anderen Wissenschaft bedarf. Umgekehrt bedienen sich die Naturwissenschaften der Mathematik, um die Welt zu erklären. Doch auch das funktioniert nicht ohne Sprache: Gleichungen, Symbole, Definitionen – sie alle sind Ausdrucksformen einer bestimmten Redeweise. Vielleicht ist die Mathematik also das konsequenteste Beispiel für nicht-objektierendes Denken, weil sie eine Welt schafft, die nur in ihrer eigenen Sprache existiert.
Die Originaltexte von Mitterer kenne ich (noch) nicht – vielleicht ist das sogar besser so, um mich nicht zu früh zu objektivieren.
Habe ich Sie da halbwegs richtig verstanden, oder steckt hinter diesem Gedanken noch eine Dimension, die mir als Techniker schlicht verborgen bleibt?
Mit besten Grüßen
Mario Kräft
Ich habe 32 Jahre benötigt, um mich zu trauen, den Text in dieser Form zu veröffentlichen. Das muss also erst sickern. Lassen Sie sich Zeit! 😉
Ein Schlüssel bzw. Zugang ist vielleicht: Die Unterscheidung zwischen Ding und Wort kommt immer erst nach dem Wort. Die Zeit läuft während dieser Unterscheidung weiter. Damit ist das Ding aber nicht mehr kategorial vom Wort verschieden.
Die Mainstream-Philosophen würden sagen: Der klassische Fehler des Idealismus. Es werden Anschauungen von Dingen mit Dingen von Anschauungen verwechselt.
Mitterer ist der Erste, der dies mit der Sprache durchexerziert hat, mit hoher analytischer Präzision.